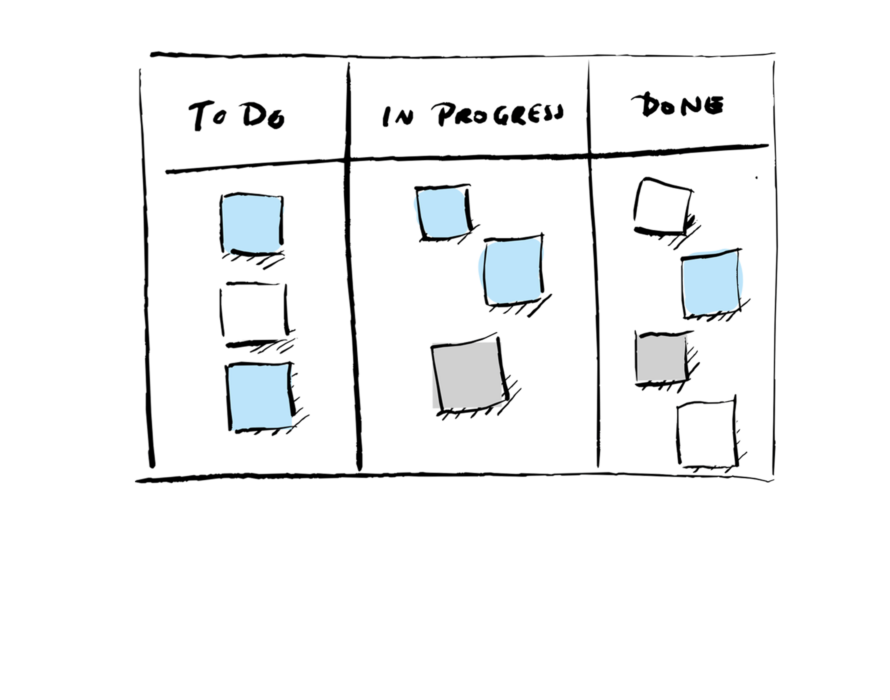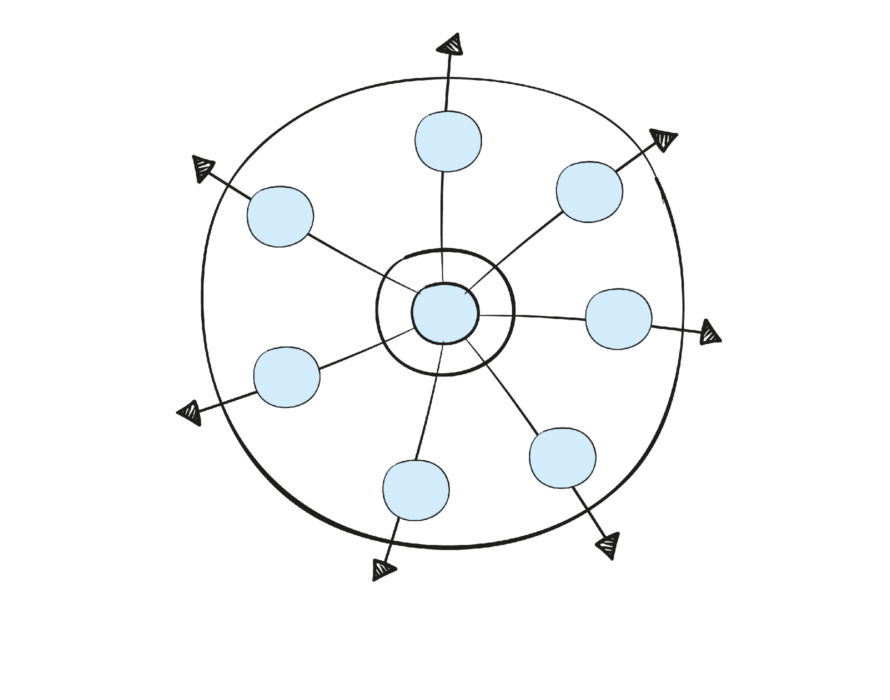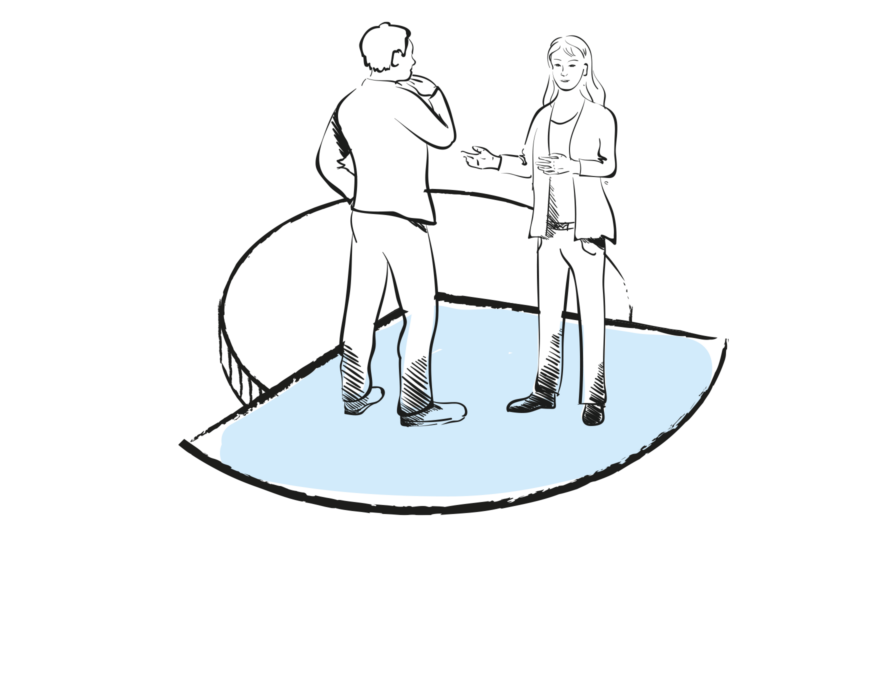Eine der größten Herausforderungen bei selbstorganisierten Projektteams liegt darin, alle Teammitglieder auf das gemeinsame Ziel einzuschwören und zu motivieren – und das ganz ohne Vorgesetztenfunktion. Wir unterstützen Sie dabei, die Kraft der kollegialen Führung optimal nutzen zu können und schwierige Situationen souverän zu meistern.
- Die Bedeutung von Selbstorganisation und kollegialer Führung
- Führungsformen und Führungsaufgaben im agilen Umfeld
- Ziele setzen und dessen Bedeutung für agile Teams
- Agile Teamdynamiken verstehen und fördern
- Umgang mit kurzen Arbeitszyklen, Fehlern, Retrospektiven und laufendem Lernen
- Entscheidungen im Team treffen
- Die Bedeutung des agilen Mindsets für die Führung
- VOPA - Vernetzung - Offenheit - Partizipation - Agilität - gelebte Formate für mehr
- Cultural Hacks - Welche Elemente und Rituale helfen uns, in der agilen Transformation auf Kurs zu bleiben